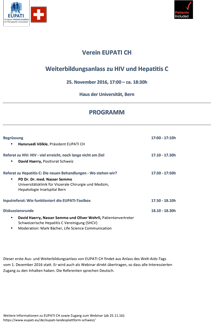Aktuell
- Details
- Kategorie: Agenda
Am Freitag, den 25. November 2016 um 17 Uhr findet im Haus der Universität in Bern ein erster Weiterbildungsanlass von EUPATI CH für Patienten und Patientenorganisationen statt. Anlässlich des Welt-Aids-Tags vom 1. Dezember fokussiert der Anlass auf die Themen HIV und Hepatitis C. Referenten sind Dr. Nasser Semmo, Leitender Arzt Hepatologie am Inselspital Bern und David Haerry vom Positivrat Schweiz. Weiter wird die Toolbox von EUPATI vorgestellt und es gibt eine Diskussionsrunde mit den Referenten und dem Patientenvertreter Oliver Wehrli von der Schweizerischen Hepatitis C Vereinigung. Für persönlich Anwesende wird anschliessend ein Apéro serviert. Alle anderen können den Anlass als Webinar mitverfolgen.
Weitere Informationen zu EUPATI CH
- Details
- Kategorie: Medienmitteilungen
Zürich, den 2. November 2016. Wir beziehen uns auf die Pressemitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vom 31.10.2016, „BAG prüft erweiterte Vergütung von Medikamenten gegen Hepatitis C“.
Das Bundesamt will offenbar die bestehenden und viel kritisierten Zugangsbeschränkungen zu Hepatitis C Therapien ausweiten. Neu sollen auch mit Hepatitis B oder HIV ko-infizierte, intravenös Drogenkonsumierende sowie erfolglos vorbehandelte Patienten Anrecht auf eine Behandlung haben. Dabei beruft sich das BAG auf einen erneuten Austausch mit medizinischen Experten.
Grundsätzlich begrüssen wir die Ausweitung auf weitere Patientengruppen. Wir können uns aber schlicht nicht vorstellen, dass die vereinten Experten dem BAG zu der im Pressetext kommunizierten Regelung geraten haben. Wir sind im Kontakt mit den wichtigsten Experten und wissen, dass der unbeschränkte Behandlungszugang für alle Menschen mit Hepatitis C gefordert wird. Dasselbe steht auch in der Reaktion des Netzwerk Schweizer Hepatitis-Strategie. Dass sich das BAG trotzdem auf die Expertenkonsultation beruft ist sehr fragwürdig.
Was das Bundesamt im Einzelnen vorschlägt ist auch nicht durchdacht. Intravenös Drogenkonsumierende sollen ein Anrecht auf eine sofortige Therapie haben, nicht Drogenkonsumierende aber nicht? Das ist absurd, ethisch fragwürdig und in der Praxis gar nicht umsetzbar.
Die Pressemitteilung des BAG ist auch tendenziös: sie suggeriert, dass heute Patienten eine Behandlung erhalten, sobald sich die Krankheit ausserhalb der Leber manifestiert. Wir wissen, dass das heute in der Schweiz in vielen Fällen nicht stimmt und symptomatischen Patienten die Behandlung verweigert wird.
Zudem würden wir es sehr begrüssen, wenn Patientenvertreter bei den BAG Konsultationen mit am Tisch sitzen dürften. Wir mögen es nicht, wenn über unsere Gesundheit amtlich verfügt wird. Die Partizipation von Betroffenen sollte man heute von einer Behörde nicht mehr einfordern müssen.
Positivrat Schweiz
Walter Bärtschi, Vorsitz, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, M +41 79 461 4666
Schweizerische Hepatitis C Vereinigung SHCV
Daniel Horowitz, Präsident, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, M +41 79 339 1859
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
Die Data Collection on Adverse Events in Anti-HIV Drugs (D:A:D) Studie ist eine Zusammenarbeit von 11 Kohortenstudien aus Europa, den USA und Australien mit 49'000 HIV-Patienten. Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie SHCS beteiligt sich seit vielen Jahren an D:A:D. Im März 2008 präsentierte D:A:D zum ersten Mal Daten, welche beim Einsatz von Abacavir eine Steigerung des Herzinfarktrisikos um 90% nahelegten. Dieser Befund erschreckte viele Patienten. Die amerikanische Behörde FDA passte die Patienteninformationen an, die europäische Behörde EMA hingegen wollte dies nicht tun – die Daten galten als zu wenig beweiskräftig.
Nach den überraschenden D:A:D Erkenntnissen von 2008 versuchten mehrere andere Studien die Resultate ebenfalls zu reproduzieren – die Ergebnisse waren unterschiedlich. Einige Studien erzielten dieselben Resultate, andere aber nicht. Einige Studien zeigten beispielsweise auf, dass die Assoziation zwischen Myokardinfarkten und Abacavir verschwand, wenn die Analysen für Nierenfunktionsstörungen und Drogengebrauch angepasst wurden. Meta-Analysen kamen auch zu unterschiedlichen Daten. Weitere Studien versuchten, die Mechanismen zu verstehen, welche den Zusammenhang erklären könnten.
Kohortenstudien sind Überwachungsstudien und haben den Nachteil, dass verschiedene Einflussfaktoren auf die Resultate einwirken können. Wenn diese bekannt sind, kann man sie berechnen und berücksichtigen, wenn nicht, wird es schwierig. Idealerweise müsste eine sogenannte randomisierte Studie den Beweis erbringen, oder eine zweite Kohortenstudie müsste den Effekt bestätigen.
2008 wurde kritisiert, dass das Medikament bevorzugt an Patienten mit einem vorbestehend erhöhten Herzinfarktrisiko verabreicht wurde und der Effekt so entstand. Abacavir wurde nämlich früher anstelle von anderen, älteren Substanzen verschrieben, welche die Blutfettwerte beeinflussen. Aufgrund dessen wurde angenommen, dass Patienten, denen Abacavir verschrieben wurde, von vornherein ein höheres Herzinfarktrisiko hatten. In der älteren Analyse wurden andere mögliche Einflussfaktoren bereits berücksichtigt: Alter der Patienten, Übertragungswege bei der Infektion mit HIV, ethnische Faktoren, Kalenderjahr, Kohorte, Rauchverhalten, familiäre und persönliche Risiken, Body Mass Index sowie andere HIV-Medikamente. Spätere Analysen berücksichtigten auch Nierenfunktionsstörungen als Einflussfaktoren.
D:A:D zeigte zudem, dass das Risiko nach Absetzen von Abacavir offenbar verschwand, und dass beim Einsatz von Tenofovir kein kardiovaskuläres Risiko nachgewiesen werden konnte. Seit 2008 wurde in Behandlungsrichtlinien auf ein mögliches Risiko hingewiesen. Die Verschreibungspraxis hat sich deshalb seither verändert. Die eben publizierte neue Studie berücksichtigt das mittlerweile bessere Verständnis der möglichen Zusammenhänge.
Die Daten wurden während der Routineuntersuchungen gesammelt. Sie umfassen sozio-demografische Faktoren, AIDS-bedingte Erkrankungen und Todesfälle, kardiovaskuläre Risikofaktoren, Laborwerte wie CD4 und Viruslast, kardiovaskuläre Erkrankungen, Therapieinformationen und Medikamente welche das kardiovaskuläre Risiko beeinflussen. Es wurden dabei drei Gruppen gebildet – die erste ab 1999 bis 2000, eine zweite ab 2004 und eine dritte ab 2009.
Die komplexen statistischen Verfahren zu erläutern würde diesen Kurzbeschrieb etwas überlasten. Das Wichtigste in Kürze: Die Daten aller beobachteten Patienten wurden einmal pro Jahr analysiert und das kardiovaskuläre Risiko auf die nächsten 10 Jahre mit der Framinghamskala analysiert. Die analysierten Patienten wurden in Risikokategorien eingeteilt und klassiert mit einem vorbestehend tiefen (unter 10%), mittleren (10-20%) oder hohen (über 20%) Risiko für Herzinfarkte oder mit unbekanntem Risiko. Es wurde auch untersucht, ob sich der 2008 beobachtete Zusammenhang zwischen Abacavir Gebrauch und Herzinfarkten seit der ersten Studie verändert hat. Interessant ist, dass der Raucheranteil seit 2005 rückläufig ist, sich die Blutfettwerte verbessert haben, durch die verbesserten Therapien die CD4-Werte anstiegen und die Viruslast allgemein tiefer war. Der Gebrauch von Abacavir hat sich zwischen dem Jahr 2000 und 2008 von gut 10% auf fast 20% verdoppelt. Nach 2008 sank er wieder leicht auf 18% ab. In der Gruppe mit mittlerem kardiovaskulärem Risiko stieg der Einsatz von Abacavir von 15% im Jahr 2000 auf über 25% im Jahr 2008 und sank 2012 auf 21%. In der Gruppe mit hohem Risiko betragen die Werte 17,5%, 26,6% und 21,7%. Nach 2008 haben Patienten mit mittlerem und hohem kardiovaskulärem Risiko seltener eine Abacavir enthaltende Ersttherapie erhalten. Bei den gleichen Gruppen wurde seit 2008 Abacavir auch häufiger als früher durch andere Substanzen ersetzt.
Laut D:A:D ist der Zusammenhang zwischen Abacavir und höherem kardiovaskulärem Risiko unverändert sichtbar. Patienten unter Abacavir hatten ein doppelt so hohes Risiko für einen Herzinfarkt im Vergleich zu den Patienten, denen kein Abacavir verschrieben wurde. Unbekannte Einflussfaktoren können aber nicht ausgeschlossen werden. Weil Abacavir zunehmend in Kombinationspillen enthalten ist, müssen wir künftig von einem vermehrten Einsatz des Medikamentes ausgehen.
Seit 2008 versuchten einige Forschungsgruppen die D:A:D Resultate zu replizieren – das gelang nicht immer, wurde aber vor allem in Überwachungsstudien gemessen. Mehrere Meta-Analysen randomisierter Studien konnten den Effekt nicht nachweisen. Es ist aber möglich, dass die in diesen Studien eingeschlossenen Patienten generell gesünder sind und ein tieferes kardiovaskuläres Risiko aufweisen. Einer der Gründe für die fortdauernde Debatte ist der Umstand dass kein biologischer Mechanismus identifiziert werden konnte.
Schlussfolgerung
Die Autoren der D:A:D sehen nach wie vor einen starken Zusammenhang zwischen gegenwärtigem Abacavirgebrauch und Herzinfarkten. Trotz dieser neuen Daten wäre eine genügend grosse randomisierte Studie welche dem Sachverhalt auf den Grund gehen würde ethisch kaum vertretbar. Fazit: kristallklar ist der Zusammenhang nach wie vor nicht. Die Autoren empfehlen aber, dass das mögliche Risiko mit den Patienten diskutiert und eine informierte Entscheidung gefällt wird.
Kommentar
Der letzte Satz, die Diskussion mit dem Patienten, erscheint uns ganz wichtig. Dieses Gespräch muss geführt werden, aber es müssen auch viele andere Faktoren in die Diskussion einfliessen. Liegen kardiovaskuläre Risiken vor, die dem Arzt vielleicht gar nicht bekannt und dem Patienten nicht bewusst sind? Stichwort Rauchen (wieviel? – die meisten Kohorten wissen nur ja/nein, haben aber keine Mengenangaben). In vielen Kohorten sind bis 60% der Patienten als Raucher bekannt. Zweites Stichwort: Kokaingebrauch – vor allem in der Schweiz ein Thema. Geben das alle Patienten zu?
Es gilt auch, die Risiken anderer Medikamente zu berücksichtigen, zu diskutieren und zu beobachten. Die wirksame und risikofreie HIV-Therapie gibt es heute und morgen nicht. Man kann beobachten, abwägen, diskutieren und in vielen Fällen eine möglichst optimale Therapie anwenden. Und die wichtigste Botschaft betreffend kardiovaskulärem Risiko an alle Patienten: nicht rauchen, kein Kokain verwenden, ausgewogene Ernährung (Mittelmeerdiät) und regelmässige Bewegung – das spart Geld und hält gesund.
David Haerry / Oktober 2016
1 C. Sabin et al, “Is there continued evidence for an association between abacavir usage and myocardial infarction risk in individuals with HIV? A cohort collaboration”, BMC Medicine (2016) 14:61 DOI 10.1186/s12916-016-0588-4
- Details
- Kategorie: Agenda
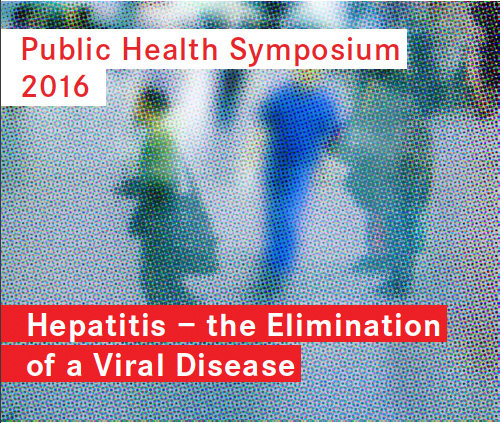
Das Public Health Symposium der Schweizerischen Hepatitis-Strategie vom 31. Oktober 2016 an der Universität Zürich steht unter dem Motto: Hepatitis - The Elimination of a Viral Disease.
Die Elimination und Hepatitis als eine systemische Krankheit, die Schaden auch ausserhalb der Leber anrichtet, sind Schwerpunkte des Anlasses mit Rednern aus dem In- und Ausland. Die Veranstaltung wird in Englisch durchgeführt.
Aktuelles Programm Public Health Symposium
Neues aus der Kohortenstudie SHCS – HIV-positive Leber verlängert das Leben eines Menschen mit HIV 1
- Details
- Kategorie: Kohorten-News POSITIV
In den meisten Ländern ist HIV-positiven Menschen die Organspende nicht erlaubt. In der Schweiz wurde die Gesetzgebung 2007 geändert. In Genf wurde nun erstmals einem HIV-positiven Patienten die Leber eines HIV-positiven Spenders transplantiert. Sowohl Spender und Empfänger wurden seit vielen Jahren therapiert, und beide hatten dokumentierte, aber kontrollierte Mehrfachresistenzen. Fünf Monate nach dem Eingriff geht es dem Organempfänger sehr gut. Eine Organspende zwischen HIV-Positiven ist also möglich.
Aufgrund vieler Befürchtungen ist die Organspende von HIV-positiven Spendern in den meisten Ländern nicht erlaubt. In den USA alleine führt diese Haltung zu einem jährlichen Verlust von ungefähr 350 Organspenden. HIV-positive Patienten, die auf ein neues Organ warten, werden auf den Wartelisten diskriminiert. Das Todesfallrisiko ist bei HIV-positiven Empfängern höher – das gilt vor allem bei mit Hepatitis C ko-infizierten Patienten. Grund für das hiesige Verbot einer Transplantation HIV-positiver Organe ist die Annahme, dass bei einer Organtransplantation von einem HIV-positiven Spender auf einen HIV-positiven Empfänger ein anderer HI-Virustyp übertragen wird, welcher beim Empfänger nicht mehr kontrolliert werden kann. Dadurch könnte das Immunsystem des Empfängers überlastet werden, und es könnten sogenannte opportunistische Infektionen auftreten.
Bis jetzt wurden nur in Südafrika die Nieren HIV-positiver Spender an ebenfalls HIV-positive Empfänger transplantiert. Die Spender waren entweder noch gar nicht therapiert, oder sie hatten noch keinen Therapiewechsel hinter sich. In den USA sind solche Transplantationen seit 2013 gesetzlich möglich, doch braucht es zur Ausführung ein bewilligtes Forschungsprotokoll, was wiederum eine unnötige Hürde ist. Zwischen 2008 und 2014 sind in der Schweiz 569 HIV-positive Menschen verstorben, davon rund 80 an einem Leberversagen. 14 HIV-positive Menschen bekamen in dieser Zeitspanne die Leber eines HIV-negativen Menschen transplantiert. Dieser Artikel dokumentiert die erste Lebertransplantation eines HIV-positiven Spenders zu einem HIV-positiven Empfänger.
Empfänger und Spender
Einem 53-jährigen HIV-positiven Mann wurde die Leber eines im Oktober 2015
verstorbenen Spenders angeboten. Der Empfänger ist seit 1987 HIV-positiv und hat sich als Drogenkonsument angesteckt. Beim Empfänger wurden zusätzlich 1997 eine Hepatitis C diagnostiziert. 2004 war diese ohne Therapie spontan geheilt. Ebenfalls hatte er früher mal eine ebenfalls spontan ausgeheilte Ansteckung mit einer Hepatitis B Infektion. Eine fortschreitende Hepatitis D wurde 2011 diagnostiziert. Diese wurde mit pegyliertem Interferon behandelt, doch die Therapie wurde vom Patienten nicht vertragen. Seit November 2014 war der Empfänger auf der Warteliste für eine Spenderleber. Sein Zustand verschlechterte sich im Sommer 2015 dramatisch.
Der Spender war ein 75-jähriger Mann, der an einer Hirnblutung verstorben ist. Er war bisexuell und wurde 1989 als HIV-positiv diagnostiziert. Spender und Empfänger hatten aus frühen Therapiekombinationen Resistenzen, waren aber erfolgreich therapiert, mit einer Viruslast unter der Nachweisgrenze. Beim Empfänger schwankten die CD4 zwischen 300 und 400 Zellen pro Mikroliter, beim Spender zum Zeitpunkt des Todesfalls 298 Zellen pro µl . Der Spender erfuhr von seinem Arzt über die Möglichkeit der Organspende, und er gab im September 2015 sein schriftliches Einverständnis. Von beiden Patienten waren die Resistenzen dokumentiert. Der Empfänger wurde vor dem Eingriff über die Resistenzen des Spenders und die dadurch nötige Therapieumstellung informiert. Er nahm das Risiko auf sich und erklärte schriftlich sein Einverständnis.
Eingriff und nachfolgende Behandlung
Die transplantierte Leber funktionierte nach dem Eingriff sofort normal. Am zweiten Tag nach dem Eingriff wurde die antiretrovirale Therapie wieder eingeleitet. Die Basistherapie rilpivirine/tenofovir/emtricitabine wurde zusätzlich mit raltegravir und enfuvirtide verstärkt. Es wurden weitere Posttransplantationsmedikamente verabreicht. Die HIV-Therapie wurde drei Monate nach dem Eingriff wieder vereinfacht.
Schlussfolgerungen und Kommentar
Die erfolgreiche Transplantation einer Leber eines HIV-positiven Spenders zu einem HIV-positiven Empfänger ist in vieler Hinsicht eine Revolution. Bisher wurden bloss 27 Nieren an HIV-positive Empfänger in Südafrika transplantiert. Bei diesen Fällen ist die Erfolgsrate gleich gut wie bei HIV-negativen Empfängern. Im Fall aus Genf waren Spender und Empfänger seit ca. 30 Jahren HIV-positiv, hatten mehrere Therapiewechsel hinter sich und auch unterschiedliche Resistenzprofile. Deshalb wurde die HIV-Therapie beim Empfänger nach dem Eingriff massiv ausgebaut– sogar das vergessene Enfuvirtide (Fuzeon) wurde aus dem Dornröschenschlaf geholt. Fünf Monate nach dem Eingriff geht es dem Patienten sehr gut. Auch die dreifache Hepatitis-Infektion spielte keine negative Rolle.
Trotz des Erfolgs bleibt ein solcher Eingriff eine Herausforderung. Medikamenteninteraktionen sowie die immunologische und virologische Kontrolle können Probleme verursachen und die medizinische Vorgeschichte sowohl des Spenders wie des Empfängers müssen lückenlos bekannt sein. Dieser Artikel ist auch eine Aufforderung an Menschen mit HIV, ihre Bereitschaft zur Organspende bei der nächsten Arztvisite zu bekunden. Auch Sie können Leben retten!
David Haerry / Oktober 2016
1 Alexandra Calmy et al, Swiss HIV and Swiss Transplant Cohort Studies, American Journal of Transplantation 2016; XX: 1–6, doi: 10.1111/ajt.13824
Seite 5 von 32