Aktuell
- Details
- Kategorie: Aus unserem Leben
Seit Anfang 2014 sind über 70 Experten aus verschiedenen Fachbereichen und Institutionen am Werk: Sie wollen eine nationale Hepatitis-Strategie erarbeiten. Der Positivrat ist in der Trägerschaft und bringt sich in den Arbeitsgruppen aktiv ein. Rund um den diesjährigen Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli läuft nun eine erste Kampagne.
Auch wenn es keine gesicherten Daten gibt: Wir können davon ausgehen, dass die Menschen in der Schweiz wenig über virale Hepatitis wissen (diese nicht repräsentative Strassenumfrage bestätigt diese Vermutung). Und dies, obwohl 80’000 Menschen in der Schweiz mit Hepatitis C leben.
Unter dem Motto: “Hepatitis: Kennst du das ABC?” wurde nun von der Strategiegruppe eine Kampagne lanciert. Auf Social-Media-Plattformen und in Behandlungszentren informiert die Kampagne die breite Bevölkerung rund um den 28. Juli über Hepatitis. Als Herzstück dient die Hepatitis Info-Plattform www.hepatitis-schweiz.ch.
Unterstützt wird die Kampagne von einem Patronatskomitee bestehend aus Komiker und Arzt Fabian Unteregger, Schriftsteller Pedro Lenz, Musiker Chris von Rohr, Ständerat Felix Gutzwiller, den Nationalräten Barbara Gysi, Jean-François Steiert, Yvonne Gilli und UN-Experte Michel Kazatchkine.
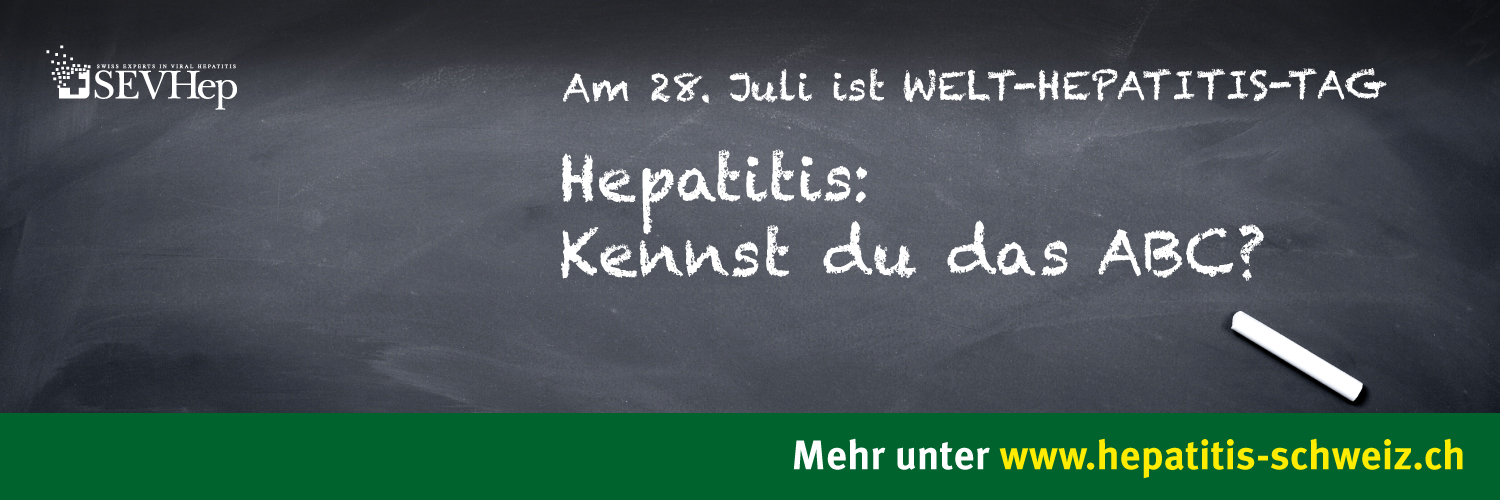
Zur Kampagne: http://www.hepatitis-schweiz.ch/de/welt-hepatitis-tag
Website über den internationalen Welt-Hepatitis-Tag: http://www.worldhepatitisday.org
- Details
- Kategorie: Aus unserem Leben
Eine HIV-Infektion kann den Alterungsprozess beschleunigen und zu Begleiterkrankungen führen. Die Therapie bekämpft zwar das Virus, kann aber zu Langzeitnebenwirkungen führen. Deshalb interessiert die Fragen, was Patientinnen und Patienten selbst beitragen können zur Lebensqualität im Alter.
Dank der guten Therapiemöglichkeiten verbunden mit einer medizinischen Betreuung haben Menschen mit HIV heute wieder eine recht gute Lebensqualität. Ihre Lebenserwartung ist vergleichbar mit derjenigen von Patienten mit anderen chronischen Krankheiten, die eine dauernde medikamentöse Behandlung erfordern. Doch wie sieht es mit der Gesundheit aus bei Menschen, die schon über längere Zeit mit dem HIV leben? Wie geht es im fortgeschrittenen Alter weiter und was können ältere Menschen selbst zu ihrer Gesundheit und Lebensqualität beitragen? Ein erster Schritt ist, dass man sich regelmässig über neue Medikamente, Nebenwirkungen, Begleiterkrankungen und deren Gegenmassnahmen informieren lässt.
HIV kann den Alterungsprozess beschleunigen
Bisherige Langzeituntersuchungen ergaben, dass HIV den Alterungsprozess beschleunigen kann. Die Medikamente bekämpfen zwar das Virus und damit den negativen Einfluss von HIV im Alterungsprozess, gleichzeitig können aber Langzeitnebenwirkungen und Begleiterkrankungen auftreten. Neun von zehn älteren Betroffenen müssen mit einer oder mehreren der folgenden Beschwerden leben: Bluthochdruck, Depressionen, Neuropathie, Lebererkrankungen, Verminderung der Nierenfunktion, Hautproblemen oder Herpes. Ein gewisses Risiko besteht auch für Tuberkulose, Osteoporose, Demenz und weitere Erkrankungen.
Teilnahme an der Schweizer HIV-Kohorte
Eine Teilnahme an der Schweizerischen HIV-Kohorte (SHCS: Swiss HIV Cohort Study: www.shcs.ch) hat für HIV-Betroffene grosse Vorteile bei vergleichsweise geringem Aufwand: Ist man bei einem der nationalen Zentren in Behandlung, werden – sofern der Patient oder die Patientin zustimmt – die Daten zum Therapieverlauf der halbjährlichen Kontrolluntersuchung an die Kohorte weitergegeben. Einerseits hilft man so mit beim Aufbau einer weltweit einzigartigen Datenbank über den Langzeitverlauf der HIV-Infektion unter antiretroviraler Behandlung, andererseits bieten die Spezialisten der Kohorte eine optimale medizinische Langzeitbetreuung, denn sie wissen genau, auf was geachtet werden muss. Die regelmässigen Kon-sultationen geben vor allem älteren HIV-Patienten die für sie wichtige Sicherheit, dass alles unter Kontrolle ist und nichts unbemerkt aus dem Ruder läuft. Bei Abnahme der Wirksamkeit der Medikamente oder wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, kann rechtzeitig eine Anpassung der Therapie vorgenommen werden. Im Rahmen der Kohorte werden jeweils auch weitere medizinische Kontrollen sämtlicher Organe durchgeführt: Niere, Leber, Herz und weitere. Es ist hilfreich, sich alle Fragen vor der Konsultation gut zu überlegen oder schriftlich vorzubereiten.
Vertrauensverhältnis Arzt/Ärztin – Patient/Patientin
Der Patient ist kein unmündiger Befehlsempfänger, sondern ein vollwertiger Partner in einem gemeinsamen Unterfangen, das heisst es braucht eine Kooperation mit dem Arzt / der Ärztin auf Augenhöhe. Unter-suchungen und Ergebnisse sowie medizinische Massnahmen werden bei der Konsultation besprochen und Entscheide werden gemeinsam gefällt. Es gibt übrigens auch Hausärzte, die an der HIV-Kohorte angeschlossen sind.
Prophylaktische Untersuchungen
Da eine Grippeerkrankung für HIV-Positive möglicherweise schwere Folgen haben kann, sollte die jährliche Grippeimpfung im Spätherbst eine Selbstverständlichkeit sein. Im Rahmen der Kohorte werden prophylaktische Untersuchungen vorgeschlagen oder routinemässig durchgeführt: Blutdruck, Urinuntersuchungen, Blutzucker und weitere Blutwerte, Nieren- und Leberfunktion, Knochendichte (also ob ein Risiko auf Osteoporose besteht), letztere damit rechtzeitig mit einer Kalzium-Substitution und Vitamin-D-Therapie begonnen werden kann. Dieses Risiko besteht auch bei älteren Männern mit HIV, weshalb manche Ärzte die Messung des Testosteronspiegels empfehlen. Ein zu tiefer Wert hat nämlich Auswirkungen sowohl auf das psychische als auch auf das physische Wohlbefinden(zum Beispiel etwa die Knochendichte). Ab fünfzig Jahren ist auch eine Darmspiegelung (Koloskopie) im Rahmen der Darmkrebs-Vorsorge angezeigt; bei Frauen Brustuntersuchung und Mammographie und bei Männern die Untersuchung der Prostata. Weitere prophylaktische Untersuchungen und sinnvolle Vorbeugemassnahmen betreffen die Augen, die Zähne, Untersuchungen auf Hautkrebs und Herpes, die Lunge, das Herz-Kreislauf-System sowie den Genitalbereich. Neigung zu Depressionen, zu starken Gemütsschwankungen und Suizidgedanken sollten bei der Konsultation besprochen und die Möglichkeit einer Behandlung abgeklärt werden. Gerade hier bietet die Kohorte einen Mehrwert: Depressionen werden von den Betroffenen selten als solche erkannt. Die Befragung im Rahmen einer Untersuchung enthält Fragen, die die Chance auf eine korrekte Diagnose einer Depression erhöhen.
Gesund leben
Ein ganz wesentlicher Punkt ist, gesund zu leben: Kurz zusammengefasst heisst dies: wenig aber ausgewogen essen, insbesondere wenig Fett, dafür genug Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe, regelmässig und genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, nicht rauchen, mässig Alkohol konsumieren. Übergewicht sollte vermieden, allenfalls reduziert werden. Wichtig sind auch genügend Schlaf (ein Mittagsschlaf tut übrigens sehr gut) sowie genügend Bewegung (indem man beispielsweise einen Schrittzähler, also einen «Activity Tracker» beschafft, der eine tägliche Bilanz ermöglicht). Gerade bei Alkohol, Tabak, Übergewicht oder auch bei starken Gemütsschwankungen oder Neigung zu Depressionen haben Männer eher Mühe, zuzugeben, dass sie etwas nicht im Griff haben und Hilfe benötigen. Es mag zwar einiges an Überwindung kosten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dies mit dem HIV-Arzt oder dem Hausarzt zu besprechen und entsprechende Therapiemöglichkeiten abklären zu lassen. Weitere Massnahmen sind Zahnhygiene, Körperpflege und –Hygiene, Haut- und Fusspflege.
Die geistige Gesundheit und eine positive Lebenseinstellung spielen im Alter eine grosse Rolle. Dazu gehören eine stabile Beziehung oder gute Freundschaften ─ so ist immer jemand da, auf den man sich ver¬lassen kann, wenn es einem einmal nicht gut geht. Wichtig ist auch die Pflege seines sozialen Netzwerkes, sich mit andern Betroffenen zu vernetzen und auszutauschen, statt sich zu isolieren. Geistig aktiv bleibt man durch regelmässiges Gehirn- und Gedächtnistraining. Es lohnt sich auch, Hobbys zu pflegen oder sich neue Hobbys zuzulegen, seine Zeit und sein aktives Altern selbst zu planen und nicht von andern Personen bestimmen zu lassen. Hierzu gehört beispielsweise, sich jeden Tag etwas vornehmen und dann am Abend Bilanz erstellen, seine Selbstachtung nicht zu vernachlässigen, sondern sich so zu akzeptieren, wie man ist. Bei Depressionen oder Gemütsschwankungen sollte man sich nicht schämen, Hilfe zu suchen. Solche Beschwerden können behandelt werden. Der Hausarzt als Vertrauensperson kann hier den Kontakt zu einem Therapeuten vermitteln.
Viele der vorgeschlagenen Massnahmen gelten generell für ältere Menschen. HIV-Patienten sind jedoch vulnerabler und haben möglicherweise auch ein vermindertes Selbstwertgefühl, weshalb diese Punkte für ein gesichertes und soweit wie möglich beschwerdefreies Altern noch mehr Bedeutung haben. Die HIV-Infek¬tion bleibt auch unter funktionierender Behandlung eine Belastung, der Betroffene kann jedoch einiges zu seiner Lebensqualität beitragen, auch im Alter. Man kann sich mit Recht fragen, ob jemand glücklich ist weil es ihm/ihr gut geht, oder ob es nicht vielleicht umgekehrt ist, dass es ihm/ihr gut geht weil er/sie glücklich ist.
Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie sucht Teilnehmende
Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie will die Auswirkung der Alterung auf die HIV-Infektion erforschen und sucht dazu noch Teilnehmende für zwei Studien: HIV und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie HIV und Hirnleistung. Die Resultate werden helfen, ältere Patienten besser zu betreuen. Interessierte ab 45 Jahren wenden sich für mehr Informationen an ihren behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin.
- Details
- Kategorie: Arbeit & Versicherung
Zürich, 28. März 2013
Ende der Diskriminierung von Menschen mit HIV in Privatversicherungen in Sicht?
Lebensversicherungen für Menschen mit HIV sind keine Utopie mehr: Eine aktuelle Studie kommt zum Ergebnis, dass über 50 Prozent der Menschen mit HIV eine Lebensversicherung abschliessen könnten. Denn die meisten HIV-positiven Menschen haben unter antiretroviraler Therapie eine nahezu normale Lebenserwartung. Damit ist der generelle Ausschluss von Menschen mit HIV aus der Lebensversicherung nicht mehr länger gerechtfertigt.
Heute werden Menschen mit HIV im Bereich der Privatversicherungen massiv diskriminiert. Ein Antrag auf eine Lebensversicherungspolice einer HIV-positiven Person wird in den meisten Fällen kategorisch abgewiesen. Dies, obwohl sich die Lebenserwartung von Menschen mit HIV dank der antiretroviralen Medikamente derjenigen der Allgemeinbevölkerung angeglichen hat. Auch Krankenzusatzversicherungen oder Einzeltaggeldversicherungen bleiben HIV-Positiven verwehrt, obwohl über 70 Prozent dieser Menschen einer Erwerbstätigkeit nachgehen und kaum häufiger krank sind als ihre Arbeitskollegen. Ein pauschaler Ausschluss von Menschen mit HIV von einer Lebensversicherung und anderen Versicherungsleistungen ist deshalb nicht mehr gerechtfertigt.
Zu diesem Schluss kommt auch eine aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift AIDS publiziert wurde. Die Autoren verglichen die Daten verschiedener europäischer Länder bezüglich Lebenserwartung von Menschen mit HIV mit Personen, die eine Lebensversicherung abgeschlossen hatten. Die Resultate zeigen, dass die Sterblichkeit von Menschen mit HIV vergleichbar ist mit derjenigen von Personen mit anderen chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes. Das macht das Leben von über 50 Prozent der Menschen mit HIV versicherbar.
Lebensversicherungen mit einer Laufzeit von 20 Jahren
Laut der Studie ist es nicht mehr gerechtfertigt, Menschen mit HIV generell Versicherungsprodukte vorzuenthalten. Den meisten HIV-positiven Menschen könnten Lebensversicherungen über eine Laufzeit von 20 Jahren angeboten werden. Die Autoren werden die Versicherungsindustrie über ihre Ergebnisse orientieren und erhoffen sich eine Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit HIV. Damit rückt der Traum vom Eigenheim oder dem eigenen Geschäft auch für Menschen mit HIV in greifbare Nähe, denn dafür braucht es heute als Garantie in der Regel eine Lebensversicherung.
Die Aids-Hilfe Schweiz und der Positivrat fordern die Versicherungen auf, von ihrer diskriminierenden Praxis abzukehren und Menschen mit HIV gleich zu behandeln wie andere Bevölke-rungsgruppen, welche heute bereits Lebensversicherungen abschliessen können. Ebenso fordern sie die Versicherer auf, ihre Praxis beim Abschluss von Krankentaggeldversicherungen und Krankenzusatzversicherungen zu revidieren.
Details zur Studie:
Die in der medizinischen Fachzeitschrift AIDS publizierte Studie schätzte die relative Sterblichkeit sechs Monate nach Beginn der antiretroviralen Therapie und verglich sie mit der versicherten Bevölkerung in jedem Land der beteiligten europäischen Kohorten, welche der ART Cohort Collaboration angeschlossen sind. Die relative Mortalität von 20-39 jährigen Patienten welche nach sechs Monaten Therapie eine CD4-Zellzahl über 350/mm3 und Virenlast unter 1‘000 erreichten und keine Aids-Diagnose haben betrug 459 Prozent. Die Sterblichkeit ist damit vergleichbar mit anderen chronischen Krankheiten, welche eine lebenslängliche Medikation brauchen, wie zum Beispiel Diabetes. Der Einfluss von HIV auf die Lebenserwartung ähnelt damit demjenigen des Rauchens. Über 50 Prozent der Menschen mit HIV würden sich aufgrund der Studienergebnisse für eine Lebensversicherung qualifizieren.
Link zur Studie
Für weitere Informationen:
Dr. Harry Witzthum, Mitglied der Geschäftsleitung der Aids-Hilfe Schweiz,
Tel.: 079 794 64 91, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Dominik Bachmann, Sekretär Positivrat Schweiz,
Tel.: 076 576 36 64, E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Details
- Kategorie: Migration
Der Positivrat lanciert ein Projekt zur Verbesserung der HIV-Therapie bei Migrantinnen und Migranten.
Der Zugang zur antiretroviralen Therapie zur Behandlung von HIV (ART) ist in der Schweiz seit 1996, dem Beginn der Erhältlichkeit von ART, gewährt. Damit die The-rapie wirkt, müssen die Medikamente jedoch regelmässig eingenommen werden. Das bedingt eine hohe Therapietreue. Oft verhindern psychische Probleme oder das Verständnis, was HIV ist und wie die Therapie wirkt, dass Patientinnen und Patienten aus anderen Kulturkreisen die Medikamente richtig einnehmen.
Das Projekt „Assessment ART-Probleme im Migrationsbereich“ will als ersten Schritt zur Verbesserung der Therapietreue von Patientinnen und Patienten aus Hochprävalenzländern die Probleme analysieren. Weshalb werden Medikamente nicht regelmässig genommen? Warum scheitern Therapieregimes? Gibt es Verständnisschwierigkeiten zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin? Wie können diese überwunden werden? Was brauchen Patientinnen und Patienten, um die Medikamente regelmässig einnehmen zu können? Die Daten werden an den Zentren der Schweizerischen HIV-Kohorte (SHCS) in Basel, Bern, Lausanne, Genf, St. Gallen und Zürich erhoben. In Interviews mit medizinischen Fachpersonen, betreuenden Personen der regionalen Aids-Hilfen sowie den Menschen mit HIV aus Hochprävalenzlän-dern, die in Behandlung sind, werden die Probleme bei der medizinischen Betreuung aus der jeweiligen Sicht der Interviewten erhoben. In einem weiteren Schritt suchen an Roundtable-Gesprächen alle Beteiligten gemeinsam nach Lösungen für die festgestellten Probleme. Das Projekt schafft damit die Grundlage, damit die Lösungen in den behandelnden Zentren eingeführt werden können.
Projektbeginn: Oktober 2012 in Basel
Projektende: Herbst 2014
- Details
- Kategorie: Aus unserem Leben
Jahrelang habe ich meinen Nächsten nichts von meiner Infektion erzählt. Zu gross waren meine Ängste. Als ich mich ihnen stellte, merkte ich, dass sie übertrieben waren. Vielen geht es ähnlich. Früher oder später überwinden aber die meisten ihre Ängste.
Der englische Begriff Disclosure lässt sich im Deutschen nur umständlich übersetzen mit «seine HIV-Infektion enthüllen». Wir sprechen vom Coming-out oder «sagen jemandem, dass ich HIV-positiv bin». Für Menschen mit einer HIV-Diagnose sind Fragen rund um das Coming-Out zentral: wem sag ich’s, wie sag ich’s, wann sag ich’s? Soll ich’s überhaupt sagen? Die Entscheidung, mit Bezugspersonen über unsere HIV-Infektion zu sprechen, wirkt sich nachhaltig auf alle Lebensbereiche aus.
Beratung
Gerade bei einer solch schwierigen Situation wäre ein Gespräch mit einer Vertrauensperson hilfreich – und genau das ist die Krux: es geht ja um die Frage, ob ich eben dieser Person meine HIV-Diagnose anvertrauen kann und will. Für dieses Dilemma gibt es keine einfachen Lösungen, doch es gibt in der Schweiz regionale Aids-Hilfen, die Menschen, die mit dieser Entscheidung ringen, Beratung anbieten. Beratung kann mich dabei unterstützen, mir die Konsequenzen meiner Entscheidung bewusst zu machen, sie abzuwägen und einzuschätzen, ob, wem, wie und wann ich es mitteilen will. Sie kann mir meine rechtlichen Möglichkeiten und weitere Aspekte aufzeigen.
Die Angst wird zum Schattenmonster
Beratung kann mir jedoch nicht den Schritt abnehmen, den ich letztendlich selber tun muss: Mich meiner Angst vor Diskriminierung wegen HIV zu stellen. Die Chinesen bezeichnen im Tai Chi eine Position mit: «den Tiger bei den Ohren packen». Das ist dieser entscheidende Moment, in dem die Prinzessin ihrer Angst Aug in Aug gegenübertritt und bereit ist, den Frosch zu küssen. Dieser Moment, in dem ich meinen ganzen Mut mobilisiere und mich der Angst stelle. Diese Angst vor Diskriminierung war für mich so ein Monster, das meine Phantasie erschaffen hatte. Und gerade weil ich dieses Monster selber erschaffen habe, konnte nur ich ihm entgegentreten und es besiegen. Leider belegen Diskriminierungsmeldungen der Aids-Hilfe Schweiz, dass auch 2012 Menschen wegen HIV in der Schweiz diskriminiert werden. Die Angst davor ist jedoch ein psychisches Schattengewächs, das im Geheimen spriesst und leicht Dimensionen annimmt, die mein Wohlbefinden und meine psychische Gesundheit beeinträchtigen können.
Verwandlung
Nach meiner HIV-Diagnose war es meine grösste Angst, dass irgendjemand davon erfahren und es weitersagen könnte. Diese Angst hing wie ein dunkler Schatten über mir und raubte mir zunehmend Kraft, Energie und Lebensfreude. Ich war absolut überzeugt davon, zu wissen, wie beispielsweise mein Vater auf meine HIV-Diagnose regieren würde. Dass er nicht so, sondern ganz anders reagierte, war ein positiver Schock, der mein Leben verändert hat. Mehr als sechs Jahre habe ich gebraucht, bis ich den Mut fand, es ihm zu sagen. Als er mich in die Arme schloss mit den Worten: «Du bist auch mit HIV meine Tochter!» brach für mich eine Welt der Angst vor Diskriminierung zusammen. Ein Schlüsselerlebnis für mich war, dass sich die Angst in dem Moment, als ich sie konfrontierte, nicht einfach nur verschwand. Sie verwandelte sich in etwas Kraftvolles, Positives, Bleibendes - in eine Art Potenzial. Mein Vater umarmte mich und wir haben seither eine bessere Beziehung als je zuvor.
Befreiung aus der Angst
Mehr noch: diese positive Erfahrung hat mich ermutigt, weitere Schritte gegen meine – so hatte ich erkannt – der Realität nicht wirklich angemessene Angst zu unternehmen. In der Folge sprach ich mit meinem Chef und mit Freundinnen über meine HIV-Infektion. Für mich ging es um die zentrale Frage: will ich dieser Angst weiterhin erlauben, mein Leben zu überschatten und zu bestimmen? Ich hatte das Glück, dass eine Therapeutin mich in diesem Prozess begleitet hat. Meine Angst hat mir den Weg gewiesen. Von meinen Ängsten kann ich lernen, sie zeigen mir auf, was es noch zu tun gibt. Die Angst ist dort am grössten, wo ich am meisten zu verlieren habe: bei den Menschen, die ich liebe. Mich meinen Ängsten zu stellen, hat mich für das Leben stark gemacht und mir aufgezeigt, wie ich mit Ängsten umgehen kann.
Studie über Frauen und die Zeitdauer bis zu ihrem Coming-out
Meinem Partner habe ich die HIV-Diagnose sofort mitgeteilt, um es weiteren Personen zu sagen, habe ich sechs oder teilweise mehr Jahre gebraucht. Eine amerikanische Studie hat nun untersucht, wie lange 125 Frauen brauchten, um ihren Partnern, Familien und Freunden ihre HIV-Diagnose zu offenbaren. Die Studienresultate bestätigen meine Einschätzung: Frauen mit einer HIV-Diagnose sagen es zuallererst ihren Lebenspartnern und erst später Familienmitgliedern oder Freunden. Diese Resultate widersprechen Studien aus den 90er Jahren, nach denen Frauen eher mit Freunden als mit Familienangehörigen über ihre HIV-Infektion sprachen. Die Autorinnen interpretieren das als Hinweis dafür, dass sich bei Frauen die Art ihrer Disclosure verändert hat. Ich bin mir sicher, dass die antiretrovirale Therapie für diese Veränderung im Disclosure-Verhalten eine wichtige Rolle spielt. Seit 1996 hat sich die medizinische Behandlung der HIV-Infektion kontinuierlich verbessert und heute muss HIV bei rechtzeitiger Diagnose nicht mehr zu Aids führen.
|
Zeitraum von HIV-Diagnose bis Coming-out |
Familie |
Kinder |
Freunde |
Partner* |
|
1 Monat nach HIV-Diagnose |
46 % |
21 % |
30 % |
45 % |
|
12 Monate nach HIV-Diagnose |
60 % |
31 % |
52 % |
71 % |
|
24 Monate nach HIV-Diagnose |
68 % |
43 % |
61 % |
75 % |
*) 5 der 173 genannten Partner (inkl. ehemalige und Liebhaber) sind weiblich Zu denken gibt angesichts der heutigen Situation, dass nach zwei Jahren noch mehr als 30 % der Frauen weder mit Familienangehörigen noch mit Freunden über HIV zu sprechen scheinen. Es dauerte immerhin 12 Jahre, bis mehr als 90 % der Studienteilnehmerinnen mit mind. einem Familienmitglied über ihre HIV-Diagnose gesprochen haben. Nach 13 Jahren (!) haben sich 97 % ihren Partnern gegenüber geoutet, und nur gerade 3 % erklärten, dies zu keinem Zeitpunkt keinem Partner gegenüber getan zu haben. Dies macht deutlich, dass einige Frauen viel Zeit und teilweise auch Jahre brauchten, um sich ihren Ängsten zu stellen. Aber es macht auch Mut: wir lassen es auf die Dauer nicht zu, dass Angst unser Leben bestimmt. Wir packen den Tiger bei den Ohren.
Text: Romy Mathys
© Aids-Hilfe Schweiz, Newsletter “POSITIV”
Quelle: Serovich Juliana Maria, Craft Shonda M., Reed Sandra J. Women’s HIV Disclosure to Family and Friends. AIDS Patient Care and STDs, Volume 26, Number 4, 2012.
Seite 4 von 8
